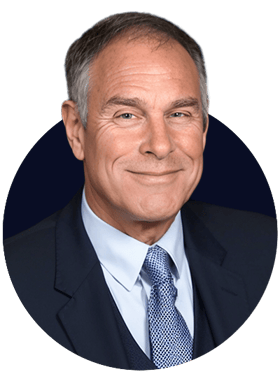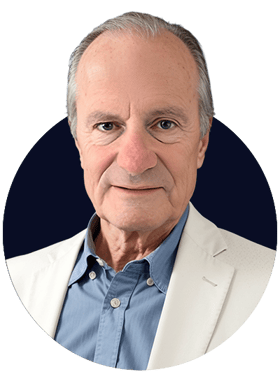Großbritanniens Geheimdienst-Fonds tritt aus dem Schatten: 330 Millionen Pfund für die technologische Kriegsführung der Zukunft
Während James Bond in den Kinofilmen noch mit explodierenden Kugelschreibern und vergifteten Zigaretten hantiert, sieht die Realität der britischen Geheimdienste heute deutlich anders aus. KI-gesteuerte Drohnen, hochverschlüsselte Kommunikationsnetzwerke und quantenbasierte Sensoren, die Signalstörungen umgehen können – das sind die Waffen des 21. Jahrhunderts. Und finanziert werden sie zunehmend durch einen bislang weitgehend im Verborgenen operierenden Fonds: den National Security Strategic Investment Fund (NSSIF).
Nach Jahren des Schattendaseins bereitet sich die britische Regierung nun darauf vor, diesem geheimnisvollen Investmentvehikel eine prominentere Rolle zuzuweisen. Begleitet wird dieser Schritt von einer massiven Finanzspritze: 330 Millionen Pfund über vier Jahre sollen die "Feuerkraft" des Fonds stärken. Eine bemerkenswerte Entwicklung, zumal das bisherige Budget des NSSIF streng geheim gehalten wird – selbst auf Nachfrage verweigerte der Fonds jegliche Auskunft über seine bisherigen Mittel.
Die Geburt eines Schattenkriegers
Als der NSSIF 2018 ins Leben gerufen wurde, befand sich die Welt nach Einschätzung von Edmund Phillips, Senior Investment Partner des Fonds, in einer "Phase des strategischen Wettbewerbs". Der Westen, so die damalige Analyse, drohte seinen technologischen Vorsprung an autoritäre Rivalen zu verlieren. Eine Einschätzung, die sich angesichts der aktuellen geopolitischen Verwerfungen als geradezu prophetisch erweist.
Geistiger Vater des Fonds war Anthony Finkelstein, ein Cybersicherheitsexperte und damaliger wissenschaftlicher Chefberater der britischen Regierung für nationale Sicherheit. Seine Vision orientierte sich am amerikanischen Vorbild In-Q-Tel, einem Venture-Fonds, der eine Pipeline neuer Technologien für die CIA schaffen sollte. Nach einem gescheiterten Versuch, einen gemeinsamen Fonds mit den USA und Australien zu etablieren, wurde der NSSIF unter dem konservativen Schatzkanzler Phillip Hammond als Joint Venture zwischen der Regierung und der British Business Bank gegründet.
"Ich war sehr daran interessiert, bessere Wege zu finden, wie die britische Sicherheitsgemeinschaft schneller und effektiver innovieren könnte", erklärte Finkelstein seine Motivation. "Und das auch als Hebel für das britische Wirtschaftswachstum zu nutzen."
Die Mechanik des verdeckten Kapitals
Bis 2023 hatte der NSSIF bereits 220 Millionen Pfund in Fonds und Start-ups investiert, die sogenannte Dual-Use-Technologien entwickeln – von quantenbasierten Chips bis zu Netzwerken erdbeobachtender Satelliten. Das Besondere dabei: Viele dieser Investitionen bleiben unter Verschluss. "Die Technologie selbst ist meist nicht geheim", verriet Finkelstein. "Geheim ist, wofür man sie einsetzt."
Die Funktionsweise des Fonds gleicht einem fein gesponnenen Netz: Speziell akkreditierte und sicherheitsüberprüfte Risikokapitalgeber halten Ausschau nach Technologien, die eines Tages Probleme für Großbritanniens Sicherheits- und Verteidigungsbehörden lösen könnten. Auf der spärlichen Website des NSSIF werden 13 Fonds als "Investmentpartner" aufgeführt, mit denen regelmäßig ko-investiert wird.
Doch die wahre Stärke des NSSIF liegt nicht nur in seiner Investitionskraft, sondern in seiner Fähigkeit, Brücken zu schlagen. "Einer der größten Beiträge, den eine Regierung zur Innovationsförderung leisten kann, ist es, ein früher Nutzer zu sein", betonte Finkelstein. Diese Verbindung hilft Start-ups, die Bedürfnisse der Geheimdienst- und Verteidigungsgemeinschaft zu verstehen, während sie gleichzeitig die Möglichkeit erhält, Technologien in einem frühen Stadium mitzugestalten.
Das Ende der Geheimniskrämerei?
Die Entscheidung, den NSSIF aus seinem Schattendasein zu holen, kommt zu einem Zeitpunkt erhöhter geopolitischer Spannungen. Der Ukraine-Krieg hat die NATO-Verbündeten aufgerüttelt und zu der Erkenntnis geführt, dass modernste Technologie schneller an die Front gebracht werden muss. Auf einem Gipfel im Juni einigten sich die NATO-Führer darauf, "das Tempo, mit dem die Allianz neue technologische Produkte einführt, erheblich zu beschleunigen – im Allgemeinen auf maximal 24 Monate."
Gleichzeitig haben geopolitische Spannungen, einschließlich Chinas Instrumentalisierung von Lieferketten und Präsident Trumps Handelszölle, Bedenken hinsichtlich der Souveränität und des Zugangs zu kritischen Technologien in den Vordergrund gerückt. Diese Entwicklung zwang die Sicherheitsbehörden zu einer "kulturellen Reise", wie Finkelstein es ausdrückte – zur Erkenntnis, dass die Wahrung des technologischen Vorsprungs aktive Verbindungen zum Privatsektor erfordert.
Wartime Innovation: Der neue Imperativ
Premierminister Keir Starmer forderte kürzlich, Großbritannien müsse "Innovation in Kriegsgeschwindigkeit vorantreiben". Ein ambitioniertes Ziel, das fundamental neue Ansätze erfordert. Das Verteidigungsministerium unternimmt bereits umfassende Reformen seiner Beschaffungsprozesse, einschließlich der Schaffung einer speziellen Defence Innovation Unit.
Steve Brierley, CEO der Quantencomputing-Firma Riverlane, die vom NSSIF unterstützt wird, sieht in der angekündigten Aufstockung eine "wirklich transformative" Entwicklung. Die zusätzlichen Mittel könnten es dem NSSIF ermöglichen, sich an größeren, späteren Finanzierungsrunden zu beteiligen und damit britische Technologieunternehmen länger im Land zu halten.
Denn genau hier liegt eine der größten Herausforderungen: Im Juni akzeptierte das Start-up Oxford Ionics eine 1,1-Milliarden-Dollar-Übernahme durch die US-Firma IonQ – ein weiteres Beispiel dafür, wie vielversprechende britische Start-ups ins Ausland abwandern. Immerhin: Der Deal dürfte Millionen von Pfund Gewinn in die Staatskasse spülen, da der NSSIF Anteile an dem Unternehmen hielt.
Die Grenzen des Erfolgs
Trotz seiner Erfolge warnen Insider davor, den NSSIF als Allheilmittel für die tief verwurzelten Probleme britischer Start-ups zu betrachten. Fünf Personen aus dem Umfeld des Fonds betonten, dass mehr Geld und Aufmerksamkeit zwar willkommen seien, der NSSIF aber seinen kommerziellen Ansatz und seinen engen Fokus auf Spitzentechnologie beibehalten müsse.
David Sully, ehemaliger britischer Diplomat und Gründer der KI-Firma Advai, die NSSIF-Investitionen erhielt, argumentierte, dass der Fonds genau solche kommerziellen Deals machen sollte, bei denen die Renditen reinvestiert werden, um die nächste Generation von Gründern zu unterstützen. Was den NSSIF einzigartig mache, sei sein kommerzieller Fokus und das "reine staatliche Eigeninteresse" – etwas, womit sich Großbritannien seiner Meinung nach noch wohler fühlen müsse.
Die Transformation des NSSIF von einem Schattenakteur zu einem öffentlicheren Instrument der Technologieförderung spiegelt einen fundamentalen Wandel in der Art und Weise wider, wie moderne Staaten ihre Sicherheit gewährleisten. In einer Welt, in der technologische Überlegenheit zunehmend über militärische Stärke entscheidet, könnte der britische Ansatz – die Verschmelzung von Geheimdienstexpertise mit kommerziellem Risikokapital – wegweisend sein. Ob dieser Ansatz jedoch den Übergang ins Rampenlicht überlebt und gleichzeitig seine Effektivität bewahrt, bleibt abzuwarten.
Eines ist jedoch sicher: In Zeiten, in denen die deutsche Ampelregierung mit ihrer desaströsen Wirtschafts- und Sicherheitspolitik das Land schwächt, zeigt Großbritannien, wie eine vorausschauende Verbindung von Sicherheitsinteressen und Wirtschaftsförderung aussehen kann. Während hierzulande Milliarden in ideologische Projekte fließen, investieren die Briten gezielt in die Technologien, die morgen über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten.
- Themen:
- #Übernahmen-Fussion
Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger
Rohstoffexperte
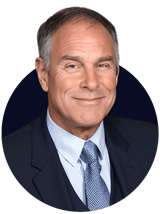
Rick Rule
Rohstoff-Legende
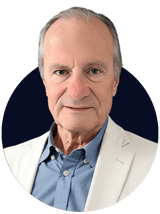
Alasdair Macleod
Chefstratege GoldMoney
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik