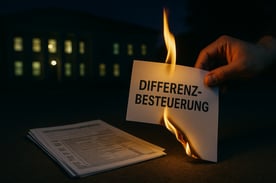Trump zieht die Reißleine: USA verlassen UNESCO wegen "Woke-Wahnsinn"
Die Vereinigten Staaten kehren der UNESCO erneut den Rücken – und diesmal könnte es endgültig sein. Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass sein Land im Dezember 2026 aus der UN-Bildungs- und Kulturorganisation austreten werde. Die Begründung des Außenministeriums liest sich wie eine schallende Ohrfeige für die internationale Organisation: Die Mitgliedschaft sei "nicht im nationalen Interesse" der USA.
Der wahre Grund: Ideologischer Kulturkampf
Was steckt wirklich hinter diesem drastischen Schritt? Die Trump-Administration wirft der UNESCO vor, eine "woke Agenda" zu verfolgen und "spaltende soziale und kulturelle Angelegenheiten" zu fördern. Mit anderen Worten: Die Organisation habe sich zu sehr dem linken Zeitgeist verschrieben und vertrete Positionen, die mit den konservativen Werten der amerikanischen Wähler unvereinbar seien.
Besonders pikant: Die Aufnahme Palästinas als Mitglied der UNESCO sei "höchst problematisch" und trage zur Verbreitung israelfeindlicher Rhetorik bei, so die US-Regierung. Trump macht damit unmissverständlich klar, wo er außenpolitisch steht – fest an der Seite Israels und gegen jede Form von Appeasement gegenüber palästinensischen Interessen.
Geschichte wiederholt sich – zum dritten Mal
Für historisch Bewanderte ist dieser Schritt keine Überraschung. Es wäre bereits der dritte Austritt der USA aus der UNESCO. Schon 1984 verließen die Amerikaner unter Ronald Reagan die Organisation wegen angeblichen Missmanagements und anti-amerikanischer Tendenzen. Nach ihrer Rückkehr 2003 folgte unter Trumps erster Amtszeit 2017 der nächste Austritt. Erst vor zwei Jahren, unter Joe Biden, kehrten die USA reumütig zurück – nur um jetzt erneut die Tür zuzuschlagen.
Diese Achterbahnfahrt zeigt deutlich: Die UNESCO ist zum Spielball amerikanischer Innenpolitik geworden. Je nachdem, wer im Weißen Haus sitzt, werden internationale Verpflichtungen wie Spielkarten auf den Tisch geworfen oder wieder eingesammelt.
UNESCO-Chefin zeigt sich "enttäuscht"
UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay reagierte erwartungsgemäß "enttäuscht" auf die Ankündigung. Ihre Verteidigung der Organisation wirkt jedoch hilflos: Man habe in 85 Ländern Lehrer ausgebildet, um über den Holocaust aufzuklären. Als ob das die grundsätzliche ideologische Schieflage der Organisation korrigieren würde!
Die Französin betonte, die Entscheidung widerspreche "den Prinzipien des Multilateralismus". Doch genau hier liegt der Hund begraben: Trump und seine Wähler haben genug von einem Multilateralismus, der amerikanische Interessen und Werte auf dem Altar der globalen Harmonie opfert.
Ein Sieg für konservative Werte?
Man mag von Trump halten, was man will – aber in diesem Punkt trifft er einen Nerv. Internationale Organisationen wie die UNESCO haben sich in den letzten Jahren zunehmend zu Vorreitern einer progressiven Agenda entwickelt, die in vielen westlichen Ländern auf Widerstand stößt. Gender-Ideologie, Klimahysterie und eine einseitige Parteinahme im Nahost-Konflikt sind nur einige Beispiele dafür, wie diese Institutionen ihre ursprüngliche Mission aus den Augen verloren haben.
Die USA tragen etwa acht Prozent des UNESCO-Budgets – Geld, das amerikanische Steuerzahler aufbringen müssen. Warum sollten sie eine Organisation finanzieren, die ihren Werten und Interessen zuwiderhandelt? Trump stellt die richtigen Fragen, auch wenn seine Antworten nicht jedem gefallen mögen.
Was bedeutet das für Deutschland?
Während die USA konsequent handeln, verharrt Deutschland in gewohnter Lethargie. Unsere Regierung wird vermutlich pflichtschuldig den amerikanischen Austritt "bedauern" und die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit betonen. Dabei wäre es an der Zeit, auch hierzulande kritisch zu hinterfragen, welche internationalen Organisationen wir mit unseren Steuergeldern unterstützen und ob diese noch unseren nationalen Interessen dienen.
Die Entscheidung der USA sollte ein Weckruf sein: Es ist legitim und notwendig, internationale Verpflichtungen auf den Prüfstand zu stellen. Gerade in Zeiten, in denen das eigene Land mit massiven Herausforderungen kämpft – von der Migrationskrise über die explodierende Kriminalität bis hin zur wirtschaftlichen Stagnation –, muss die Frage erlaubt sein: Cui bono? Wem nützt es?
Trump mag mit seiner brachialen Art polarisieren, aber er spricht aus, was viele denken: Es reicht. Die Zeit der bedingungslosen Unterwerfung unter internationale Organisationen und ihre ideologischen Verirrungen ist vorbei. Amerika macht es vor – wann folgt Europa?
- Themen:
- #FED

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik