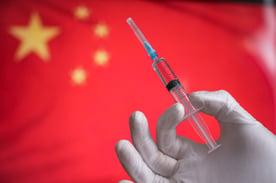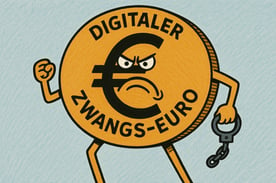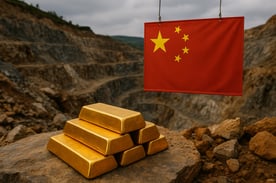
Trumps Zollpolitik würgt Asiens Wirtschaft ab: China und Südostasien kämpfen mit Deflationsspirale
Die neuesten Wirtschaftsdaten aus China und Südostasien offenbaren eine beunruhigende Entwicklung: Während die Erzeugerpreise im Reich der Mitte dramatisch einbrechen und die Inflation in den ASEAN-Staaten merklich nachlässt, zeigt sich ein Muster, das weit über regionale Konjunkturschwankungen hinausgeht. Hinter den nackten Zahlen verbirgt sich eine Geschichte globaler Verwerfungen – und im Zentrum steht ausgerechnet Donald Trumps protektionistische Handelspolitik.
Chinas Industrie im freien Fall
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Chinas Erzeugerpreisindex stürzte im Juni um beachtliche 3,6 Prozent im Jahresvergleich ab – der stärkste Rückgang seit fast zwei Jahren. Damit setzt sich die Deflation auf Produzentenebene bereits seit 33 Monaten ununterbrochen fort. Während die Verbraucherpreise mit einem minimalen Plus von 0,1 Prozent technisch gesehen die Deflation beendet haben, bleibt die Kerninflation mit mageren 0,7 Prozent auf besorgniserregend niedrigem Niveau.
Was sich hier abspielt, ist mehr als nur eine vorübergehende Schwächephase. Die chinesische Industrie kämpft mit massiven Überkapazitäten, während gleichzeitig die Nachfrage sowohl im In- als auch im Ausland schwächelt. Besonders in Schlüsselsektoren wie der Automobil-, Batterie- und Solarindustrie tobt ein gnadenloser Preiskampf. Unternehmen versuchen verzweifelt, ihre Lagerbestände zu räumen – koste es, was es wolle.
Südostasien als Kollateralschaden im Handelskrieg
Die Auswirkungen dieser Entwicklung bleiben nicht auf China beschränkt. Thailand, oft als Inflationsbarometer der ASEAN-Region betrachtet, verzeichnete im Juni bereits den dritten Monat in Folge sinkende Verbraucherpreise. Der Rückgang um 0,25 Prozent mag moderat erscheinen, doch Ökonomen warnen vor den langfristigen Folgen. Das Land, ohnehin durch politische Unsicherheit und eine schleppende Erholung des Tourismussektors geschwächt, wird regelrecht mit billigen chinesischen Waren überschwemmt.
Singapur meldet mit 0,8 Prozent die niedrigste Inflationsrate seit der Pandemie, während Malaysia mit 1,2 Prozent ein Vierjahrestief erreichte. Was oberflächlich wie eine willkommene Entlastung für Verbraucher aussehen mag, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als gefährliche Deflationsspirale, die die gesamte Region zu erfassen droht.
Die Trump-Doktrin als globaler Preiskiller
Die Wurzel dieser Verwerfungen führt direkt nach Washington. Trumps aggressive Zollpolitik – 20 Prozent auf EU-Importe, satte 34 Prozent auf chinesische Waren – hat die globalen Handelsströme fundamental verändert. Chinesische Produzenten, vom lukrativen US-Markt abgeschnitten, fluten nun Südostasien mit ihren Überkapazitäten. Was als "America First"-Politik verkauft wurde, erweist sich als globaler Brandbeschleuniger für deflationäre Tendenzen.
Ironischerweise exportiert Trump damit genau das, was er zu bekämpfen vorgibt: wirtschaftliche Instabilität. Seine protektionistischen Maßnahmen mögen kurzfristig amerikanische Arbeitsplätze schützen, doch sie destabilisieren ganze Regionen und schaffen neue Abhängigkeiten. Die asiatischen Volkswirtschaften werden zu Spielbällen einer Politik, die vorgibt, nationale Interessen zu vertreten, tatsächlich aber globale Verwerfungen produziert.
Japan als Menetekel
Selbst Japan, mit seinen robusten Institutionen und dem Versuch, sich aus der ultralockeren Geldpolitik zu befreien, bleibt nicht verschont. Während die Kerninflation noch bei 3,7 Prozent liegt, sind die Großhandelspreise bereits drei Monate in Folge gefallen. Die Bank of Japan steht vor einem Dilemma: Weitere Zinserhöhungen riskieren, die Wirtschaft abzuwürgen, während ein Kurswechsel die mühsam erkämpften Fortschritte zunichtemachen könnte.
Die neue Realität: Inflation als politische Waffe
Was wir hier beobachten, ist nichts weniger als eine Zeitenwende. Inflation und Deflation sind nicht länger primär nationale Phänomene, die durch lokale Geld- und Fiskalpolitik gesteuert werden können. Sie sind zu transnationalen Variablen geworden, die durch politische Entscheidungen in Washington mehr beeinflusst werden als durch die Zentralbanken in Peking oder Bangkok.
Die Trump-Administration hat, ob gewollt oder nicht, Inflation zu einer politischen Waffe gemacht. Während man in Washington von der Wiederbelebung der amerikanischen Industrie träumt, kämpfen Unternehmen von Shanghai bis Jakarta ums nackte Überleben. Die Preisschilder in asiatischen Supermärkten erzählen heute mehr über die amerikanische Außenpolitik als über lokale Wirtschaftsbedingungen.
Gold als sicherer Hafen in stürmischen Zeiten
In diesem Umfeld geopolitischer Verwerfungen und wirtschaftlicher Unsicherheit gewinnen traditionelle Wertaufbewahrungsmittel wieder an Bedeutung. Während Papierwährungen durch politische Entscheidungen entwertet werden können und Aktienmärkte von Handelskriegen erschüttert werden, bieten physische Edelmetalle wie Gold und Silber einen bewährten Schutz. Sie sind immun gegen die Launen der Politik und haben sich über Jahrhunderte als krisenfeste Anlage bewährt. Gerade in Zeiten, in denen die Weltwirtschaft zum Spielball politischer Machtspiele wird, sollte jeder Anleger über eine solide Beimischung von Edelmetallen in seinem Portfolio nachdenken.
Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Jeder Anleger muss seine Investitionsentscheidungen selbst treffen und trägt die volle Verantwortung für seine Anlageentscheidungen. Wir empfehlen, sich umfassend zu informieren und gegebenenfalls professionellen Rat einzuholen.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik