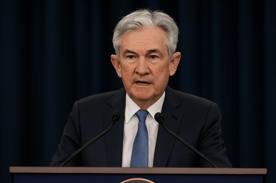Deutschlands Start-up-Szene im Sinkflug: Wenn selbst Trump-Amerika attraktiver wirkt
Die deutsche Gründerszene schlägt Alarm: Der einstige Wirtschaftsmotor Deutschland verliert dramatisch an Zugkraft. Nur noch magere 57 Prozent der Start-up-Gründer bewerten den Standort positiv – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Was sich hier abzeichnet, ist nicht weniger als ein schleichender Exodus der Innovationskraft aus einem Land, das sich einst als Ingenieurnation rühmte.
Die bittere Realität hinter den Zahlen
Besonders alarmierend: Die Bereitschaft zur Neugründung bröckelt. Während vor zwei Jahren noch fast 90 Prozent der Befragten erneut den Schritt in die Selbstständigkeit wagen würden, sind es heute nur noch 78 Prozent. Ein Rückgang von über zehn Prozentpunkten in nur zwei Jahren – das ist kein statistisches Rauschen, sondern ein Weckruf.
Die Ironie der Geschichte? Ausgerechnet das Trump-Amerika mit seinen protektionistischen Zöllen und politischen Unwägbarkeiten lässt Deutschland im direkten Vergleich besser dastehen. Knapp 40 Prozent der heimischen Gründer sehen die Bundesrepublik mittlerweile als attraktiver an als die USA – ein Anstieg um sechs Prozentpunkte. Doch dieser vermeintliche Erfolg ist nichts als ein Pyrrhussieg.
Wenn Stabilität zur Stagnation wird
„Deutschland erscheint vergleichsweise stabil", heißt es im aktuellen Startup Monitor. Doch was nützt Stabilität, wenn sie zur lähmenden Stagnation verkommt? Die deutsche Bürokratie erstickt Innovation im Keim, während andere Länder mit schnelleren Verfahren und besseren Rahmenbedingungen locken.
„Wir müssen endlich mehr Kapital mobilisieren", fordert Verena Pausder vom Startup-Verband.
Eine Forderung, die seit Jahren wie ein Mantra wiederholt wird – ohne dass sich Entscheidendes tut. Deutschland belegt beim Zugang zu Risikokapital unter den 40 größten Volkswirtschaften nur den beschämenden 18. Platz. Selbst Frankreich, das hierzulande gerne belächelt wird, hat uns längst abgehängt.
Die Kapitalmisere als Innovationsbremse
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Während in anderen Ländern Milliarden in zukunftsträchtige Technologien fließen, darbt die deutsche Start-up-Szene am Tropf einer risikoscheuen Finanzlandschaft. Die neue Große Koalition unter Friedrich Merz hatte Besserung versprochen – doch statt mutiger Reformen erleben wir das übliche Klein-Klein der Berliner Politik.
Besonders bitter: Ausgerechnet im Bereich der Verteidigungstechnologie explodieren die Investitionen – von 1,3 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 878,5 Millionen in den ersten acht Monaten dieses Jahres. Ein Sektor boomt, während die zivile Innovation darbt. Ist das die Zukunft, die wir uns für Deutschland wünschen?
Die Universitäten als letzter Lichtblick
Einzig die Nähe zu den Universitäten wird von den Gründern noch gelobt. Doch was nützt exzellente Forschung, wenn die Absolventen ihre Ideen mangels Kapital und aufgrund bürokratischer Hürden im Ausland verwirklichen müssen? Die Bundesrepublik bildet Talente aus, nur um sie dann an innovativere Standorte zu verlieren.
Die Merz-Regierung steht vor einer Herkulesaufgabe. Das 500-Milliarden-Sondervermögen für Infrastruktur mag gut gemeint sein, doch es droht in den üblichen Kanälen zu versickern, statt echte Innovation zu fördern. Was Deutschland braucht, sind keine neuen Schulden, sondern eine radikale Entbürokratisierung und ein Umdenken in der Kapitalkultur.
Das Fazit ist ernüchternd: Deutschland verliert den Anschluss an die globale Innovationselite. Während andere Länder mutig voranschreiten, verwaltet die Bundesrepublik ihren schwindenden Wohlstand. Die Start-up-Szene sendet ein deutliches Signal – es ist höchste Zeit, dass die Politik endlich zuhört und handelt. Sonst bleibt von der einstigen Wirtschaftsmacht Deutschland nur noch eine nostalgische Erinnerung.
Silber-Explosion 2026:Das unterschätzte Edelmetall
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Ernst Wolff
Der Systemkritiker

Jochen Staiger
Der Rohstoff-Realist
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik