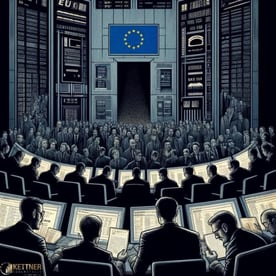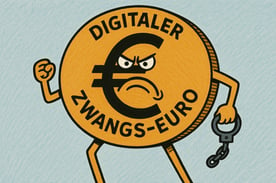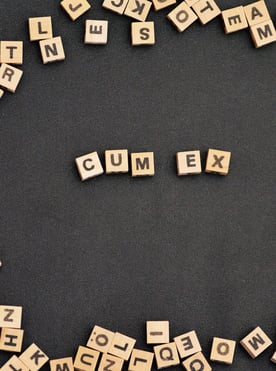
EU-Drohnenwall: Teures Luftschloss gegen billige Bedrohungen
Die EU-Bürokratie hat wieder einmal ein neues Prestigeprojekt entdeckt, das Milliarden verschlingen dürfte: Nach wiederholten russischen Luftraumverletzungen träumen neun EU-Mitgliedstaaten und die Ukraine von einem gemeinsamen "Drohnenwall". Was nach modernster Verteidigungstechnologie klingt, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als typisches Brüsseler Luftschloss.
EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius will am Freitag per Videoschaltung mit Vertretern der betroffenen Staaten über erste Vorschläge zur Stärkung der Drohnenabwehr sprechen. Dabei geht es um die acht an Russland oder die Ukraine angrenzenden EU-Mitgliedstaaten sowie Dänemark und die Ukraine selbst. Die Tatsache, dass man sich nach Jahren des Konflikts erst jetzt zu einer Videokonferenz durchringt, spricht Bände über die Handlungsfähigkeit der EU in Verteidigungsfragen.
Von der Leyens Luftnummer
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte Mitte des Monats vollmundig einen europäischen "Drohnenwall". Eine "gemeinsam entwickelte, gemeinsam eingesetzte und gemeinsam aufrechterhaltene europäische Einrichtung, die in Echtzeit reagieren kann", schwebt ihr vor. Wer die Arbeitsgeschwindigkeit der EU-Bürokratie kennt, dürfte bei dem Begriff "Echtzeit" nur müde lächeln.
Die Realität sieht ernüchternd aus: Vor zwei Wochen drangen zahlreiche russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein. Die NATO musste Kampfjets der neuesten Generation aufsteigen lassen, die mit teuren Lenkflugkörpern die billigen russischen Drohnen abschossen. Ein wirtschaftlicher Wahnsinn – man bekämpft Spielzeugdrohnen im Wert von wenigen hundert Euro mit Millionen teuren Hightech-Waffen.
Vage Vorstellungen statt konkreter Pläne
Nach EU-Angaben existieren bislang nur "vage Vorstellungen" über die Ausgestaltung des Drohnenwalls. Als möglicher erster Schritt wurde der Einsatz zusätzlicher Sensoren an der östlichen EU-Außengrenze genannt. Ein integriertes gemeinsames Abwehrsystem zur Drohnenabwehr dürfte "erheblich zeitaufwändiger" sein, heißt es aus Brüssel. Im Klartext: Man hat keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber Hauptsache, man redet darüber.
Besonders pikant: Die Ukraine, die seit über drei Jahren im Abwehrkampf gegen Russland steht, hat ihre Fähigkeiten zur kosteneffizienten Aufspürung und Abwehr von Drohnen längst ausgebaut. Während die EU noch Videokonferenzen abhält, verteidigt sich die Ukraine täglich gegen reale Bedrohungen. Vielleicht sollten die EU-Bürokraten weniger reden und mehr von den Ukrainern lernen.
Deutschlands Rolle im Drohnen-Theater
Während die EU von einem "Drohnenwall" träumt, hat Deutschland unter der Großen Koalition andere Prioritäten. Das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für Infrastruktur wird vermutlich eher in Radwege und Genderprojekte fließen als in effektive Drohnenabwehr. Die Klimaneutralität bis 2045 wurde sogar im Grundgesetz verankert – als ob das Klima auf deutsche Gesetze hören würde.
Die zunehmende Bedrohung durch Drohnen ist real, doch statt pragmatischer Lösungen produziert die EU-Maschinerie wieder einmal heiße Luft. Ein "Drohnenwall" klingt beeindruckend, wird aber vermutlich genauso effektiv sein wie die meisten EU-Großprojekte: teuer, ineffizient und Jahre zu spät.
Was Europa wirklich bräuchte, wären schnelle, unbürokratische Lösungen und eine Rückbesinnung auf traditionelle Verteidigungsfähigkeiten. Stattdessen verliert man sich in Videokonferenzen und Absichtserklärungen, während die Bedrohungen täglich zunehmen. Der "Drohnenwall" droht zum nächsten Milliardengrab zu werden – finanziert vom deutschen Steuerzahler, der sich gleichzeitig gegen die explodierende Kriminalität im eigenen Land nicht mehr sicher fühlen kann.
- Themen:
- #Steuern
Silber-Explosion 2026:Das unterschätzte Edelmetall
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Ernst Wolff
Der Systemkritiker

Jochen Staiger
Der Rohstoff-Realist
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik