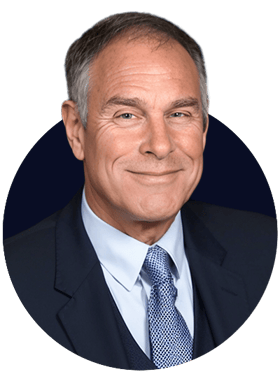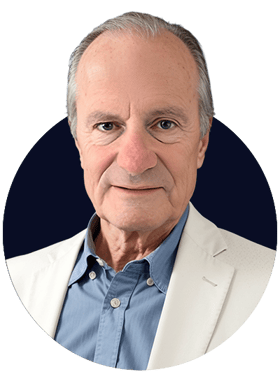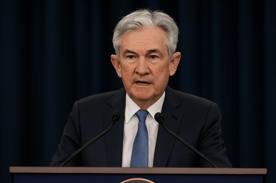Handelsstreit offenbart tiefe Gräben zwischen amerikanischen und europäischen Lebensmittelstandards
Das erste Handelsabkommen der Trump-Administration nach ihrer globalen Zolloffensive wirft ein grelles Licht auf die fundamentalen Unterschiede zwischen amerikanischen und europäischen Ansätzen zur Lebensmittelsicherheit. Während Washington von "wissenschaftsbasierten" Standards spricht, verteidigen London und Brüssel ihr Vorsorgeprinzip mit Zähnen und Klauen.
Ein Deal mit bitterem Beigeschmack
Der am 16. Juni unterzeichnete "Economic Prosperity Deal" zwischen den USA und Großbritannien verspricht amerikanischen Landwirten Marktzugänge im Wert von fünf Milliarden Dollar. Doch was auf den ersten Blick wie ein Durchbruch aussieht, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als Mogelpackung. Die Briten haben ihre roten Linien gezogen: Hormonbehandeltes Rindfleisch und chlorgewaschenes Hähnchen bleiben draußen.
Präsident Trump versuchte während einer Pressekonferenz im Oval Office die Wogen zu glätten, indem er betonte, die Briten könnten sich aus dem amerikanischen Angebot nehmen, was sie wollten. Interessanterweise erwähnte er auch, dass Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. daran arbeite, die amerikanischen Lebensmittelstandards in Richtung der europäischen zu verschieben - "ohne Chemikalien, ohne dies, ohne das".
Der Kampf der Philosophien
Was hier aufeinanderprallt, sind zwei grundverschiedene Weltanschauungen. Die Amerikaner pochen auf ihre "risikobasierte" Herangehensweise, bei der erst gehandelt wird, wenn wissenschaftlich bewiesen ist, dass etwas schädlich ist. Die Europäer hingegen schwören auf ihr Vorsorgeprinzip: Im Zweifel für die Sicherheit der Verbraucher.
Diese philosophische Kluft zeigt sich besonders deutlich beim Thema Ractopamin, einem in den USA weit verbreiteten Futtermittelzusatz für Schweine. Während amerikanische Produzenten behaupten, es gebe keine wissenschaftlichen Beweise für dessen Schädlichkeit, haben über 160 Länder - darunter sogar China und Russland - die Substanz verboten. Die Forschung zu den gesundheitlichen Auswirkungen auf Menschen ist praktisch nicht existent, aber Verbindungen zu Gesundheitsproblemen bei Tieren haben weltweit Alarmglocken läuten lassen.
Die Chlorhuhn-Saga
Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins versuchte bei einem Besuch in London, mit dem "Chlorhuhn-Mythos" aufzuräumen. Nur etwa fünf Prozent des amerikanischen Geflügels werde noch so behandelt, betonte sie. Stattdessen verwende die Industrie jetzt hauptsächlich Peressigsäure - im Grunde eine industrielle Version von Wasserstoffperoxid und Essig.
Doch das verfehlt den Punkt. Die Briten stören sich nicht am Chlor selbst - sie erlauben es sogar. Was sie ablehnen, ist die dahinterstehende Philosophie: Chlorwäsche als Pflaster für niedrige Hygienestandards in der Massentierhaltung. Während Großbritannien auf ein "Farm-to-Fork"-Modell setzt, das Lebensmittelhygiene in allen Produktionsstufen nachverfolgt, verlassen sich die Amerikaner traditionell auf Tests am Ende der Kette.
Pestizide: Ein weiteres Schlachtfeld
Bei Pestiziden zeigt sich die Kluft noch deutlicher. Die USA erlauben für viele Lebensmittel Pestizidrückstände, die hundertmal höher sind als in Großbritannien. Während die Briten planen, chemische Pestizide in den nächsten Jahren schrittweise abzuschaffen, gibt es in den USA keine vergleichbaren Pläne.
Die Environmental Protection Agency hat bereits signalisiert, dass sie kein "europäisches Mandatssystem, das Wachstum erstickt" zur Reduzierung des Pestizideinsatzes einführen wird. Ein klares Signal, dass die Trump-Administration trotz Kennedys Gesundheitsinitiative nicht gewillt ist, die amerikanische Landwirtschaft fundamental umzukrempeln.
Gewinner und Verlierer
Britische Bauernverbände zeigen sich erleichtert über die Ausnahmen im Abkommen. Tom Haynes vom britischen Schweinezüchterverband warnte, dass amerikanische Importe die britischen Preise unterbieten und jahrzehntelange Fortschritte bei Standards zunichtemachen würden. "Waren ins Land zu lassen, die nach Standards produziert wurden, die für unsere Produzenten illegal wären, wäre ein Verrat an britischen Bauern", so Haynes.
Auf der anderen Seite des Atlantiks hoffen amerikanische Produzenten auf weitere Zugeständnisse. Die International Dairy Foods Association feierte das Abkommen als längst überfälligen Schritt, während die U.S. Meat Export Federation bereits auf die Aufnahme von Schweinefleisch drängt.
Ein Blick in die Zukunft
Das Abkommen mag ein erster Schritt sein, aber es offenbart die tiefen Gräben zwischen amerikanischen und europäischen Ansätzen zur Lebensmittelsicherheit. Während die USA auf Innovation und Effizienz setzen, beharren die Europäer auf Tradition und Vorsicht. Der ehemalige US-Botschafter in Großbritannien, Robert Wood Johnson, verglich Europa einst mit einem "Museum der Landwirtschaft" - eine Charakterisierung, die den philosophischen Graben perfekt illustriert.
Interessanterweise könnte die neue Große Koalition in Deutschland unter Friedrich Merz hier eine Vermittlerrolle spielen. Als traditionell wirtschaftsfreundliche Partei könnte die CDU versucht sein, im Rahmen künftiger EU-US-Handelsabkommen Kompromisse zu suchen. Doch angesichts der tief verwurzelten Skepsis der deutschen Verbraucher gegenüber amerikanischen Lebensmittelstandards dürfte auch Merz hier vorsichtig agieren müssen.
Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass Handelsabkommen mehr sind als nur Zahlen und Zölle. Sie sind Ausdruck fundamentaler Wertvorstellungen darüber, wie wir leben, essen und wirtschaften wollen. Und in dieser Hinsicht scheinen Amerika und Europa weiter voneinander entfernt denn je.
In Zeiten wachsender geopolitischer Unsicherheiten und inflationärer Tendenzen bieten physische Edelmetalle wie Gold und Silber eine bewährte Möglichkeit zur Vermögenssicherung. Als zeitlose Wertaufbewahrungsmittel haben sie sich über Jahrhunderte als krisenfest erwiesen und gehören in jedes ausgewogene Anlageportfolio.
- Themen:
- #CDU-CSU
Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger
Rohstoffexperte
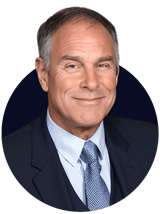
Rick Rule
Rohstoff-Legende
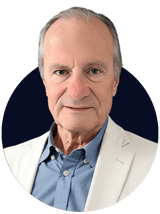
Alasdair Macleod
Chefstratege GoldMoney
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik