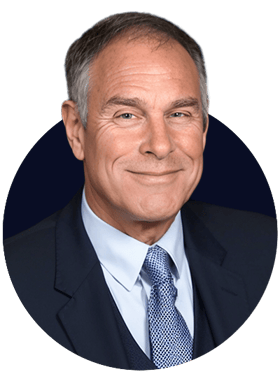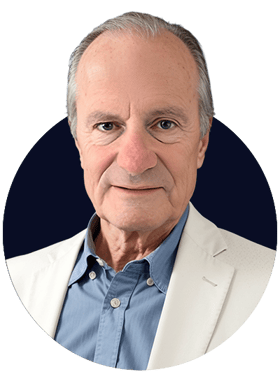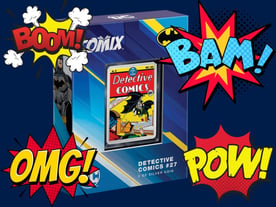
Italiens Brückenschlag zur NATO-Quote: Wenn Kreativität auf Verteidigungsausgaben trifft
Während Deutschland sich in bürokratischen Windungen verliert und bei jeder EU-Vorgabe zur Übererfüllung neigt, zeigt Italien einmal mehr, wie man mit mediterraner Finesse politische Vorgaben zum eigenen Vorteil interpretiert. Die Regierung unter Giorgia Meloni plant nicht nur eine spektakuläre 13,5 Milliarden Euro teure Brücke über die Meerenge von Messina – sie möchte dieses Prestigeprojekt gleich auch noch als Beitrag zu den NATO-Verteidigungsausgaben deklarieren.
Ein Meisterstück italienischer Staatskunst
Die Idee ist so simpel wie genial: Die geplante Verbindung zwischen dem italienischen Festland und Sizilien soll als sogenanntes "Dual-Use-Projekt" eingestuft werden – also sowohl zivil als auch militärisch nutzbar. Vizepremiers Matteo Salvini und Antonio Tajani argumentieren, die Brücke könne im Ernstfall strategische Bedeutung für die NATO haben. Damit ließe sich ein erheblicher Teil der Baukosten den Verteidigungsausgaben zurechnen und Italien käme dem ambitionierten 5-Prozent-Ziel näher, ohne tatsächlich Milliarden in Panzer und Kampfjets investieren zu müssen.
Aktuell gibt Italien lediglich 1,5 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus. Die von der NATO geforderten 5 Prozent erscheinen für die meisten europäischen Staaten als kaum zu stemmen – eine Tatsache, die in Brüssel niemand offen auszusprechen wagt. Während deutsche Politiker reflexartig nach Wegen suchen, jede Vorgabe penibel zu erfüllen, beweisen die Italiener einmal mehr ihre Fähigkeit zur kreativen Auslegung internationaler Vereinbarungen.
Brüsseler Stirnrunzeln und römisches Schulterzucken
Die Reaktionen aus Brüssel fallen erwartungsgemäß skeptisch aus. "Es ist ein nationaler Infrastrukturplan, aber sicher kein NATO-Projekt", wird ein EU-Offizieller zitiert. Doch was kümmert es Rom, wenn Brüssel die Stirn runzelt? Italien hat über Jahrzehnte bewiesen, dass man EU-Vorgaben durchaus flexibel interpretieren kann, ohne gleich als Regelbrecher dazustehen.
"Das gefällt mir an italienischen Politikern. Ob EU-Gesetze oder sonstige Vorgaben, sie wählen schlau die Light-Version in angemessenem Tempo, während Deutschland zum eigenen Schaden zur Übererfüllung neigt."
Diese Einschätzung eines Kommentators trifft den Nagel auf den Kopf. Während Deutschland seine Infrastruktur verfallen lässt und gleichzeitig brav jeden Euro in tatsächliche Rüstungsgüter steckt, denken die Italiener praktisch: Eine Brücke nutzt der Bevölkerung täglich, könnte aber theoretisch auch mal einen Panzer tragen.
Die deutsche Misere im Vergleich
Der Kontrast zu Deutschland könnte kaum größer sein. Hierzulande sind viele Brücken in einem derart desolaten Zustand, dass sie für schwere Militärfahrzeuge gar nicht mehr passierbar sind. In Bayern wurde das zulässige Gewicht für eine Brücke sogar auf 3,5 Tonnen begrenzt – ein Leopard-Panzer wiegt 60 Tonnen. Doch anstatt diese marode Infrastruktur als sicherheitsrelevant einzustufen und entsprechend zu sanieren, diskutiert man in Berlin lieber über Gendersternchen und Klimaneutralität.
Die neue Große Koalition unter Friedrich Merz hat zwar vollmundig ein 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Infrastruktur angekündigt, doch gleichzeitig die Klimaneutralität bis 2045 im Grundgesetz verankert. Diese Schuldenberge werden Generationen belasten und die Inflation weiter anheizen – all das, obwohl Merz versprochen hatte, keine neuen Schulden zu machen. Ein klassisches Beispiel deutscher Politik: große Versprechen, teure Symbolpolitik und am Ende zahlt der Bürger die Zeche.
Kreativität versus Bürokratie
Die italienische Herangehensweise mag man als "kreative Buchführung" kritisieren, doch sie offenbart eine grundlegende Wahrheit: Die geforderten 5 Prozent des BIP für Verteidigung sind für die meisten europäischen Staaten schlicht unrealistisch. Diese Forderung dient primär den Interessen der amerikanischen Rüstungsindustrie, die sich über garantierte Milliardenaufträge freuen kann.
Meloni beweist mit diesem Schachzug, dass sie die Interessen ihres Landes geschickt vertritt. Anstatt blind Milliarden in Waffensysteme zu pumpen, investiert Italien in Infrastruktur, die der Bevölkerung unmittelbar zugutekommt. Dass man diese Ausgaben dann auch noch als Verteidigungsbeitrag deklarieren möchte, zeugt von politischem Geschick, das man in Berlin schmerzlich vermisst.
Ein Lehrstück in Realpolitik
Ob die Brücke über die Meerenge von Messina jemals gebaut wird, steht in den Sternen. Die Region ist seismisch aktiv, die technischen Herausforderungen gewaltig. Doch darum geht es letztlich gar nicht. Italien demonstriert, wie man mit internationalen Vorgaben umgeht: Man nickt höflich, interpretiert kreativ und macht am Ende das, was dem eigenen Land nützt.
Deutschland täte gut daran, sich eine Scheibe von dieser Flexibilität abzuschneiden. Statt reflexhaft jede Vorgabe überzuerfüllen und dabei die eigenen Bürger zu schröpfen, sollte auch Berlin lernen, Spielräume zu nutzen. Doch dafür bräuchte es Politiker, die ihr Land an erste Stelle setzen – und nicht internationale Organisationen oder ideologische Luftschlösser.
Die Italiener mögen ihre Brücke am Ende als NATO-Projekt deklarieren oder nicht. Eines haben sie bereits bewiesen: Während andere Länder brav zur Kasse gebeten werden, findet Rom elegante Wege, die eigenen Interessen zu wahren. In Zeiten, in denen die Kriminalität in Deutschland Rekordniveau erreicht und die Infrastruktur zerfällt, während gleichzeitig Milliarden für fragwürdige Projekte verpulvert werden, könnte ein wenig italienische Schlitzohrigkeit durchaus erfrischend sein.
- Themen:
- #CDU-CSU
Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger
Rohstoffexperte
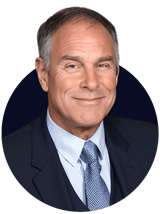
Rick Rule
Rohstoff-Legende
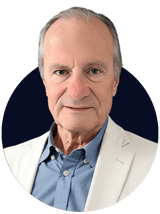
Alasdair Macleod
Chefstratege GoldMoney
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik