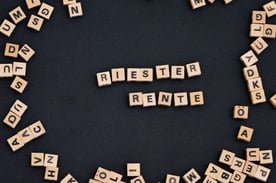Merz' Militärpläne stoßen im Osten auf taube Ohren: Unternehmen verweigern Bundeswehr-Unterstützung
Die große Koalition unter Friedrich Merz treibt die Militarisierung Deutschlands mit Hochdruck voran. Während der Bundeskanzler vollmundig die Wirtschaft zur Abstellung von Reservisten auffordert, zeigt sich ausgerechnet in Ostdeutschland ein bemerkenswertes Phänomen: Die Unternehmen mauern. Was als patriotischer Schulterschluss verkauft werden soll, entpuppt sich als weiterer Beleg für die Realitätsferne der Berliner Politik.
Die neue Wehrpflicht durch die Hintertür
Am Mittwoch brachte das Bundeskabinett das Gesetz zur Einführung eines neuen Wehrdienstes auf den Weg. Verteidigungsminister Boris Pistorius träumt von einer Bundeswehr mit 260.000 Soldaten plus 200.000 Reservisten bis Ende des Jahrzehnts. Eine gewaltige Aufrüstung, die an düstere Zeiten erinnert. Doch statt die Bürger direkt zu verpflichten, sollen nun die Unternehmen ran – eine Wehrpflicht durch die Hintertür, könnte man meinen.
Merz forderte beim Tag der Industrie Ende Juni, Mitarbeitern müsse „die Gelegenheit" gegeben werden, „hin und wieder mit Streitkräften zu üben". Man fragt sich unwillkürlich: Wann sollen die Menschen eigentlich noch arbeiten? In Zeiten des akuten Fachkräftemangels sollen Betriebe ihre besten Leute für militärische Übungen abstellen?
Ostdeutsche Skepsis als Stimme der Vernunft
Die Reaktion aus Ostdeutschland spricht Bände. Von den größten Unternehmen der neuen Bundesländer wollte sich kaum eines zu Merz' Forderungen äußern. Carl Zeiss AG, VNG AG, Lausitz Energie Kraftwerke AG, das Porsche-Werk Leipzig – sie alle lehnten eine Stellungnahme ab. Ein beredtes Schweigen, das mehr sagt als tausend Worte.
Einzig Christoph Günther, Geschäftsführer der InfraLeuna GmbH, wagte sich aus der Deckung. Seine Worte sollten in Berlin aufhorchen lassen: Die Mitarbeiter würden „sehnlichst auf ein baldiges Ende des Krieges hoffen". Skepsis herrsche bei der Frage, ob die Bundeswehr überhaupt einen relevanten Beitrag dazu leisten könne. Ein vernichtender Befund für die Kriegsrhetorik der Regierung.
Wirtschaft unter Druck – und jetzt auch noch Wehrdienst?
Günther bringt es auf den Punkt: „Die Industrieunternehmen stehen unter hohem wirtschaftlichem Druck." Gute Fach- und Führungskräfte seien knapp und gerade aktuell stark gefordert. Genau diese Kräfte sollen nun der Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden? In einer Zeit, in der deutsche Unternehmen gegen internationale Konkurrenz kämpfen, in der die Energiepreise explodieren und die Bürokratie erdrückt?
Die ostdeutschen Industrie- und Handelskammern versuchen einen diplomatischen Spagat. Man stehe „grundsätzlich" zur Verantwortung, heißt es aus Halle-Dessau. Doch zwischen den Zeilen liest man die Verzweiflung: Der Fachkräftemangel stelle bereits jetzt eine der größten Herausforderungen dar. Wie soll da noch Personal für militärische Abenteuer abgestellt werden?
Kleine Betriebe als Verlierer der Militarisierung
Besonders pikant: 94 Prozent der ostdeutschen Betriebe haben weniger als zehn Beschäftigte, wie die IHK Dresden vorrechnet. Für diese Kleinunternehmen wäre der Verlust auch nur eines Mitarbeiters existenzbedrohend. Während Konzerne wie Amazon oder die Deutsche Bahn vielleicht verkraften könnten, Personal abzustellen, würde es den Mittelstand – das Rückgrat der deutschen Wirtschaft – hart treffen.
Die IHK Cottbus fordert „klare Rahmenbedingungen" und warnt vor unverhältnismäßigen Nachteilen für Unternehmen. Man könnte auch sagen: Die Wirtschaft soll die Zeche für eine verfehlte Außenpolitik zahlen, die Deutschland immer tiefer in internationale Konflikte verstrickt.
Ein Land auf Kriegskurs – gegen den Willen der Bürger
Was sich hier abspielt, ist symptomatisch für die aktuelle Politik: Statt auf Diplomatie und Deeskalation zu setzen, wird aufgerüstet, was das Zeug hält. Das 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur, das die neue Regierung plant, wird Generationen belasten. Die Klimaneutralität bis 2045 wurde sogar im Grundgesetz verankert – ein ideologisches Projekt, das weitere Milliarden verschlingen wird.
Gleichzeitig explodiert die Kriminalität, Messerangriffe durch Migranten sind an der Tagesordnung. Doch statt diese realen Probleme anzugehen, träumt man in Berlin von einer schlagkräftigen Bundeswehr. Die Prioritäten könnten verkehrter nicht sein.
Ostdeutschland als Mahner
Die zurückhaltende bis ablehnende Reaktion der ostdeutschen Wirtschaft sollte als Warnsignal verstanden werden. Hier, wo man die Folgen ideologischer Experimente noch in lebendiger Erinnerung hat, ist die Skepsis gegenüber großen Plänen aus Berlin besonders ausgeprägt. Zu Recht.
Wenn selbst die Industrie- und Handelskammern, die normalerweise regierungsnah agieren, vor einer „einseitigen Belastung von Unternehmen" warnen, dann läuft etwas gewaltig schief. Die Signale aus Ostdeutschland sind eindeutig: Von einem Schulterschluss mit der Bundeswehr ist man weit entfernt.
Deutschland braucht keine Aufrüstung, sondern eine Rückbesinnung auf das, was dieses Land stark gemacht hat: fleißige Unternehmer, innovative Produkte und eine Politik, die sich um die wahren Probleme der Bürger kümmert. Die ostdeutsche Wirtschaft hat das verstanden. Wann versteht es Berlin?
- Themen:
- #CDU-CSU

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik