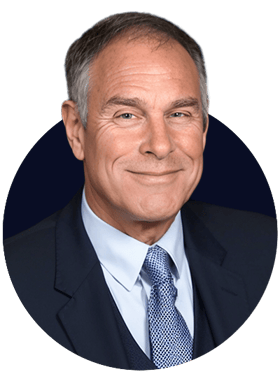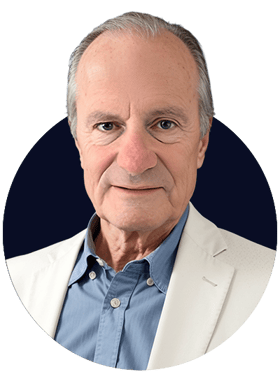Siemens Energy passt sich neuer US-Politik an: Frauenquote wird gestrichen
Die Zeiten ändern sich – und mit ihnen die Unternehmensstrategien. Nach dem Softwarekonzern SAP hat nun auch Siemens Energy seine Frauenquote in den USA abgeschafft. Was auf den ersten Blick wie ein Rückschritt in Sachen Gleichberechtigung aussehen mag, ist bei genauerer Betrachtung eine pragmatische Anpassung an die neue politische Realität unter Präsident Donald Trump.
Rechtliche Vorgaben zwingen zum Handeln
Der deutsche Energietechnikkonzern reagiert damit auf eine Executive Order des US-Präsidenten, die sich gegen Programme für Diversität, Gleichstellung und Inklusion (DEI) richtet. Die Verordnung mit der Nummer 14173 trägt den unmissverständlichen Titel "Beendigung radikaler und verschwenderischer DEI-Programme und Bevorzugungen in der Regierung". Trump argumentiert, dass diese Programme eine "enorme Verschwendung öffentlicher Mittel" darstellten und zu "beschämender Diskriminierung" führten.
Für Siemens Energy bedeutet dies konkret: Die erst 2020 weltweit eingeführte Frauenquote, die einen Anteil von 25 Prozent Frauen in den obersten Führungsebenen bis 2025 und 30 Prozent bis 2030 vorsah, gilt in den USA nicht mehr. Bislang lag der weltweite Frauenanteil bei etwa 24 Prozent – die 13.000 US-Mitarbeiter eingeschlossen.
Zwischen Prinzipien und Pragmatismus
Maria Ferraro, Vorständin bei Siemens Energy und zuständig für Finanzen sowie Inklusion und Diversität, betont: "Auch wenn wir diese Zielvorgaben geändert haben, ändert sich nichts an unseren gelebten Werten und Überzeugungen, nämlich Frauen nicht zu benachteiligen." Diese Aussage zeigt das Dilemma, in dem sich deutsche Konzerne mit bedeutenden US-Geschäften befinden.
"Siemens Energy ist nicht eingeknickt, aber wir müssen uns an geltendes Recht halten, das ist alternativlos"
So bringt es Christina Schulte-Kutsch, Personalchefin bei Siemens Energy, auf den Punkt. Die Entscheidung sei keine ideologische, sondern eine rechtliche Notwendigkeit.
Wirtschaftliche Interessen im Vordergrund
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 stieg der Umsatz von Siemens Energy in den USA um beeindruckende 22,4 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro. Der Auftragseingang legte sogar um 57,2 Prozent zu und erreichte 7,6 Milliarden Euro. Der Boom beim Bau von Rechenzentren treibt den Strommarkt an – und damit das Geschäft von Siemens Energy.
Angesichts dieser Zahlen wird klar, warum das Unternehmen nicht riskieren kann, von öffentlichen Aufträgen in den USA ausgeschlossen zu werden. Die Trump-Verordnung betrifft nämlich explizit Unternehmen, die Aufträge oder Fördermittel über Bundesbehörden erhalten.
Weitere Anpassungen folgen
Neben der Abschaffung der Quote streicht Siemens Energy auch geschlechtsspezifische Förderprogramme in den USA. Führungskräfte erhalten dort keine Boni mehr für die Erhöhung des Frauenanteils. Ob diese Maßnahmen auch Auswirkungen auf andere Länder haben werden, prüft das Unternehmen derzeit noch.
Ein Trend zeichnet sich ab
Mit SAP und Siemens Energy haben bereits zwei DAX-Konzerne ihre Diversitätsprogramme in den USA angepasst. SAP-Chef Christian Klein hatte die Entscheidung damit begründet, dass sehr viele Jobs bei SAP vom US-Geschäft im öffentlichen Sektor abhingen. Die Juristen hätten eine klare Empfehlung ausgesprochen.
Diese Entwicklung zeigt, wie stark die Politik eines einzelnen Landes globale Unternehmensstrategien beeinflussen kann. Deutsche Konzerne stehen vor der Herausforderung, ihre weltweiten Standards mit lokalen rechtlichen Anforderungen in Einklang zu bringen.
Fazit: Realpolitik statt Ideologie
Die Entscheidung von Siemens Energy mag manchen als Rückschritt erscheinen. Doch sie zeigt vor allem eines: In der globalisierten Wirtschaft müssen Unternehmen flexibel auf politische Veränderungen reagieren. Die neue US-Politik zwingt deutsche Konzerne zu einem Spagat zwischen ihren Werten und wirtschaftlichen Notwendigkeiten.
Interessanterweise betont Siemens Energy weiterhin auf seiner US-Webseite: "Wir glauben an Diversität." Das Unternehmen versichert, keine Personalentscheidungen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion oder Geschlecht zu treffen. Die Abschaffung der Quote bedeutet also nicht automatisch das Ende der Gleichberechtigung – sie macht nur deren Messung und Incentivierung unmöglich.
In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer Spannungen zeigt sich einmal mehr: Unternehmen müssen sich anpassen, um zu überleben. Während Aktien volatil bleiben und politische Risiken zunehmen, bieten physische Edelmetalle wie Gold und Silber eine bewährte Möglichkeit zur Vermögenssicherung. Sie sind unabhängig von politischen Entscheidungen und Unternehmensstrategien – ein beruhigender Gedanke in turbulenten Zeiten.
- Themen:
- #Aktien
Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger
Rohstoffexperte
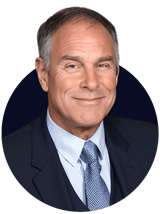
Rick Rule
Rohstoff-Legende
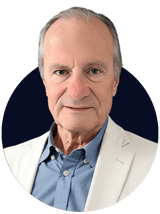
Alasdair Macleod
Chefstratege GoldMoney
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik